Von Britta Mathéus
Svenja Flaßpöhler ist umstritten. Immer wieder gerät sie mit ihren provokanten Äußerungen ins Kreuzfeuer. Dementsprechend vielstimmig fallen die Urteile zu ihrem aktuellen Sachbuch Sensibel aus, indem sie eine Reise durch die Jahrhunderte und verschiedene beteiligte Wissenschaften unternimmt, um das aktuell heiß umkämpfte Thema der gesellschaftlichen Empfindlichkeit zu ergründen. Kein Wunder – denn auch wenn sie sich vornimmt, „frei von Polemik“ zu argumentieren, so liefert sie doch genug Zündstoff, um diejenigen Leser in die Luft gehen zu lassen, die nur darauf warten. Doch wer den Filter beiseitelegen mag, könnte in diesem Buch einen höchst wertvollen Beitrag zur aktuellen gesellschaftlichen Debatte finden.
Niemand kann Svenja Flaßpöhler ernsthaft vorwerfen, dass sie für feministische Ziele und die gesellschaftliche Gleichberechtigung diskriminierter Minderheiten nichts übrig hätte. Zu sehr decken sich Flaßpöhlers Ideen, die sie auch in ihrer Streitschrift Die potente Frau dargelegt hat, mit denen einer gewissen Judith Butler, und überall im vorliegenden Buch wird ersichtlich, dass sie die Vorstellung einer fairen, gleichberechtigten und diversen Gesellschaft für eine durchweg positive, wünschenswerte zivilisatorische Zielsetzung hält.
In ihrem neuen Buch widmet sich Svenja Flaßpöhler einer Frage, die sie als eine der zentralen im aktuellen Streit zwischen linker Twitterbubble und konservativem Lager definiert: der Frage nach den „Grenzen des Zumutbaren“, wie es im Untertitel heißt. Sie nimmt dafür den Begriff der gesellschaftlichen ‚Sensibilität‘ im Umgang miteinander, insbesondere im Umgang mit Minderheiten und benachteiligten Gruppen in den Fokus, und stellt ihm das Phänomen der ‚Resilienz‘, die Stärkung des Individuums, gegenüber. Die größte Problematik liegt auf der Hand: Die Unterscheidung zwischen dem Pochen auf Eigenverantwortung und victim blaming ist ein Tanz auf Messers Schneide. Fasst man den Begriff der Resilienz als Forderung auf, dass sich alle nicht so anstellen sollen, hat das wenig mit seinem psychologischen Verständnis zu tun. In der Psychologie ist die Resilienzforschung eine der großen Hoffnungsträgerinnen der letzten Jahre – dabei geht es mitnichten darum, Ungerechtigkeit zu schlucken und wehrlos hinzunehmen, sondern um die Stärkung der persönlichen Schutzfaktoren, um den Widrigkeiten des Lebens entgegentreten zu können.
Flaßpöhlers Ideal formuliert sie als Kombination beider Extreme: Sensibilität gegenüber klarer Ungerechtigkeit bei gleichzeitiger Resilienz gegenüber den ambivalenten, missverständlichen und potenziell verletzenden menschlichen Zusammenstößen im gemeinsamen Lebensraum. Die große Stärke ihrer Argumentation ist ihre Differenzierungsfähigkeit. Es gelingt ihr, den Konflikt zwischen links und rechts kritisch zu beleuchten, und zugleich fair mit beiden Fronten umzugehen, auch wenn deutlich wird, dass sie weder die eine, noch die andere Meinung teilt. Sie räumt jedem Diskursteilnehmer gute Gründe für ihre jeweilige Haltung ein. Weder verteufelt sie diejenigen, die sagen, jeder sei selbst verantwortlich für den eigenen Schutz, noch käme sie auf die Idee, den von massiver Diskriminierung Betroffenen ihren Anspruch auf gesellschaftlichen Schutz und die berechtigte Frustration abzusprechen. Und doch nimmt sie Unterscheidungen vor, zwischen persönlicher Erfahrung und politisch-moralischer Dimension, zwischen subjektiver Verletzung und objektivem Fehltritt, zwischen gesellschaftlicher und individueller Verantwortung; sie beleuchtet genau jene Graubereiche, die das Thema so unglaublich kompliziert machen.
Klar wird in ihrem Buch auch: Dieses Phänomen ist nicht neu, sondern seit Jahrhunderten gesellschaftlich und literarisch begründet. Es ist ein Produkt der gesellschaftlichen Neuordnung durch Demokratie, Abschaffung des Adels und der Klassengesellschaften, der Aufklärung, der Frauenrechtsbewegung. Es ist weder durch das Internet entstanden, noch ist es ein Phänomen, das ausschließlich von den Generationen „Snowflakes“ vs. „Boomer“ ausgetragen wird. Der Konflikt ist historisch gewachsen und begleitet uns in unseren Bemühungen, gesellschaftliches Leben zu gestalten. Und er wird uns weiterhin begleiten. Wir werden ihn ebenso wenig mit der Ignoranz der berechtigten Bedürfnisse benachteiligter Gesellschaftsgruppen, wie mit einer Verpflichtung zur Nutzung gendergerechter Sprache in offiziellen Dokumenten beilegen können.
Mehr noch, wir werden wohl überhaupt nicht diejenigen sein, die ihn beilegen können. Höchstwahrscheinlich werden die heute lebenden Generationen nicht die letzten sein, die mit diesem Widerspruch, der fehlenden Kontingenz und der Uneindeutigkeit menschlicher Identität und der Herausforderung gesellschaftlichen Zusammenlebens zu hadern haben, weil sie notwendig und unauflöslich mit der Ambivalenz unseres Daseins verknüpft sind. Von dem enormen Druck, endlich die Generation zu sein, die es ein für alle mal richten wird, können wir uns also guten Gewissens befreien. Verantwortung für die Art und Weise, wie wir den Konflikt an die uns folgenden Generationen weitergeben, tragen wir dennoch. Zugunsten eines konstruktiven, an Inhalten orientierten Diskurses wäre schon viel gewonnen, wenn sich jeder, der sich am öffentlichen Diskurs beteiligen möchte, mit der im vorliegenden Buch formulierten Prämisse auseinandersetzt, dass auch grundsätzlich positive Entwicklungen das Potenzial für negative, gar gefährliche Nebenwirkungen in sich tragen.
Auch eine an sich so wunderbare Idee wie die Auflösung starrer, widerlegter und veralteter gesellschaftlicher Kategorien führt eben nicht einfach automatisch zur gewünschten Gleichwertigkeit eines jeden, sondern läuft Gefahr, dass sich aus ihr neue, zwar ausdifferenzierte, aber in ihrer Diversität wiederum einengende, weil extrem klar definierte Kategorien bilden, und auch Kategorielosigkeit führt vielleicht nicht direkt zur erhofften Klarheit, sondern sorgt stattdessen für völlige Verunsicherung.
So findet Flaßpöhler auch die Sensibilität dementsprechend nicht ausnahmslos gut, auch wenn sie ihre grundlegenden Ziele befürwortet – nachgewiesenermaßen zeigt sich Empathie umso stärker, je ähnlicher uns unser Gegenüber ist. Unsere Fähigkeit, uns in andere hineinzuversetzen, hat somit nicht nur das Potenzial, uns dem anderen näher zu bringen – so groß dieses Potenzial auch ist –, sondern birgt auch die Gefahr, die Gräben zwischen den Gruppen, die – aus welchem Grund auch immer – uns fremder scheinen, noch tiefer zu ziehen. Was darauf ausgelegt ist, uns zu einen, droht uns zu spalten. Das, was eigentlich zu gleichberechtigter, auf Augenhöhe stattfindender, respektvoller Debatte führen sollte, führt zu Gruppenbildung, Abschottung und immer radikalerem Auftreten auf beiden Seiten. Denn jede noch so positive, begrüßenswerte Bewegung kann ihr destruktives Potenzial entfalten, wenn sie sich radikalisiert, wenn sie zu viel zu schnell will, Veränderungen notfalls mit Gewalt und gegen alle Widerstände durchsetzen und erzwingen will.
Ein Leben in einer freiheitlichen, gleichberechtigten Gesellschaft fordert von jedem von uns, dass wir uns selbst kontrollieren, dass jeder der eigene ärgste Kritiker ist. Je diverser die Gesellschaft, umso wichtiger die Sensibilität. Je weniger feststehend die gesellschaftlichen Konventionen, umso mehr ist jeder von uns auf sich gestellt, das Richtige zu tun. Doch es wäre naiv, zu denken, dass die gesellschaftlichen Umgangsformen verschwänden, nur weil sie nicht mehr von außen erzwungen werden.
Was stattdessen passiert, ist ein höchst interessanter psychologischer Effekt, den Flaßpöhler in ihrem Ausflug in die Psychoanalyse und die menschliche Psyche zu skizzieren versucht: Wenn es keine äußeren Verhaltensregeln gibt, so erlegt der Mensch sie sich selbst auf. Was früher äußerer Zwang war, verinnerlichen wir nun, legen hohe Maßstäbe an uns selbst und das eigene Verhalten an, und schaffen uns unsere eigene interne Kontrollinstanz, unser Gewissen, das alles sieht und bewertet, was wir tun und sagen. Der große Wunsch nach Eindeutigkeit, der sich in den zur Zeit von den eigentlich so freiheitsliebenden Linken geforderten strengen Regeln und Maßnahmen zur Eindämmung struktureller Diskriminierung widerspiegelt, wird aus diesem Sachverhalt ebenso nachvollziehbar wie die atemberaubende Masse der unter Depressionen leidenden Menschen, die unter der Last der Verantwortung für jedes Unglück der Welt und dem Gefühl des Nicht-Ausreichens zusammenbrechen.
Heruntergebrochen könnte man vielleicht sagen, Flaßpöhlers Hauptaussage zu der Vielzahl der unter dem Überbegriff „Sensibilität“ miteinander verstrickten aktuellen Debatten ist: Es ist alles nicht so einfach, wie wir es vielleicht gerne hätten, und erst recht nicht eindeutig. Natürlich hört das niemand gern, der sich seiner Überzeugungen so gerne so sicher wäre. Dennoch werden wir es nie ausschließen können, dass es im Miteinander zu Missverständnissen, Konflikten und auch Verletzungen kommen wird, und für diesen so schwierigen Weg des gesellschaftlichen Miteinanders ist es gut, gewappnet zu sein – sowohl mit einem guten Maß an gesellschaftlicher Sensibilität, als auch mit einer gesunden Maß individueller Resilienz.
* * *
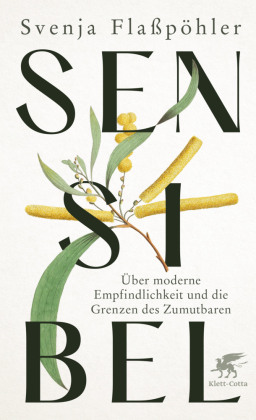
Svenja Flaßpöhler: Sensibel. Über moderne Empfindlichkeit und die Grenzen des Zumutbaren
Klett-Cotta 2021
240 Seiten / 20 Euro
Kaufen bei: 
#supportyourlocalbookstore
Foto: Saydung89 / pixabay.com
