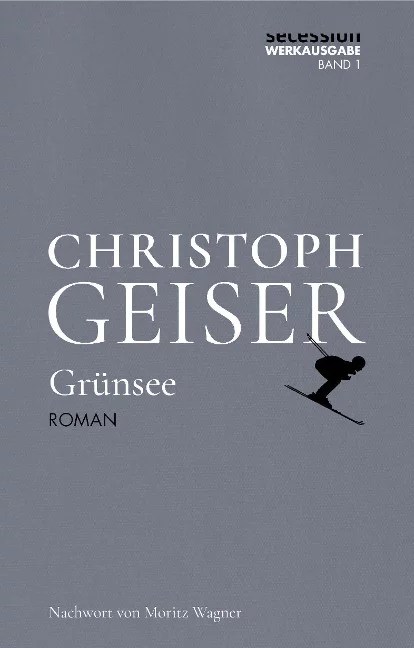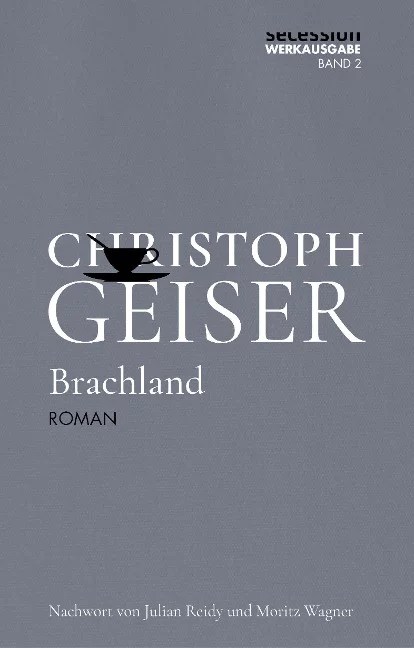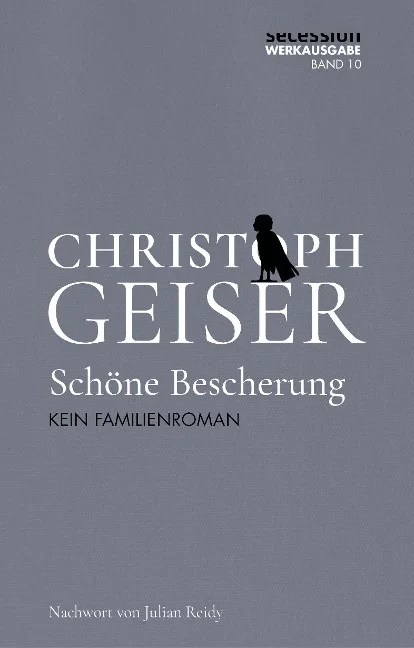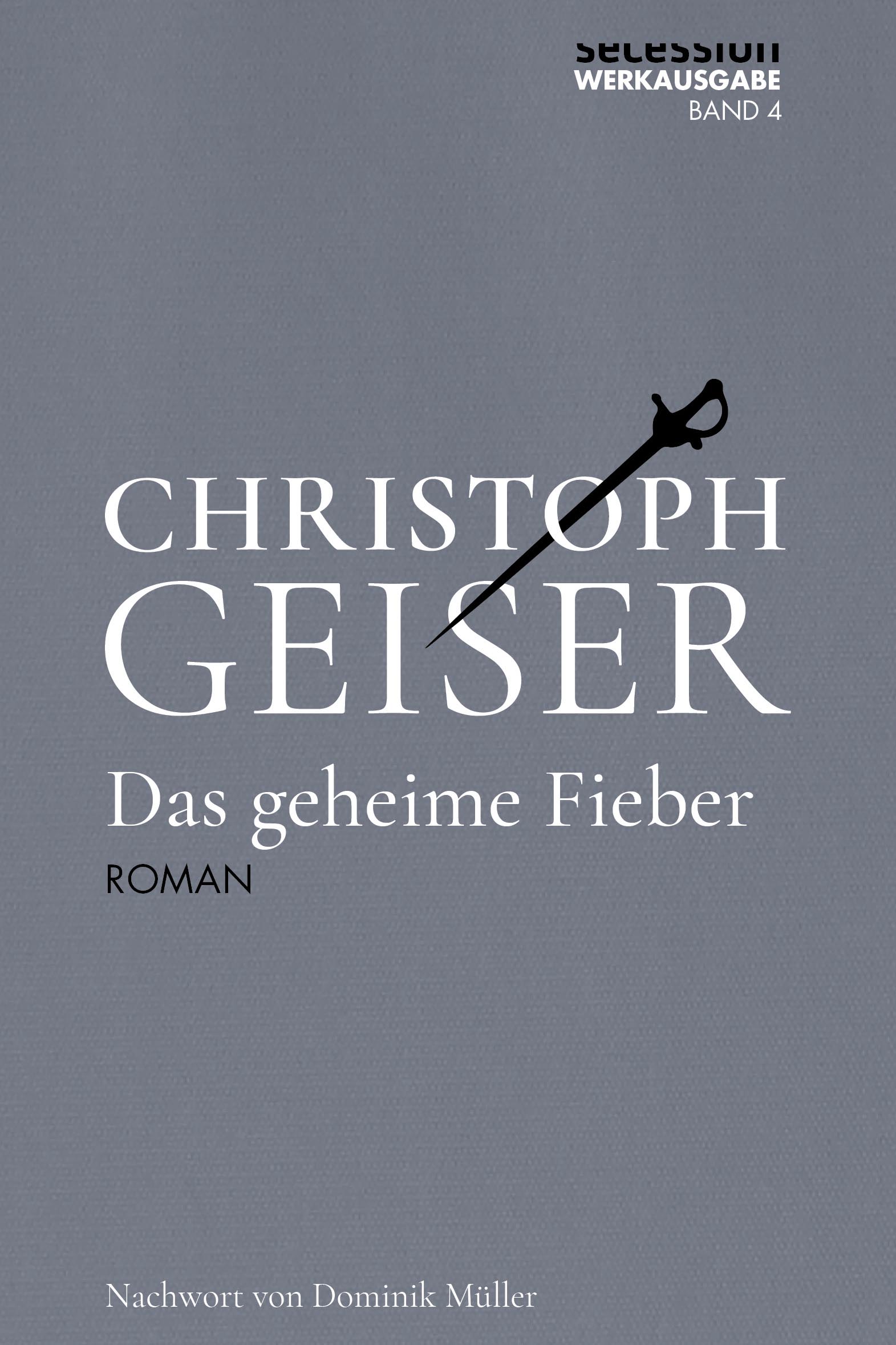Von Jascha Feldhaus
Nach einem langen schriftstellerischen Leben würdigt der Secession Verlag das literarische Schaffen Christoph Geisers mit einer 13-bändigen Werkausgabe. Es wirkt wie ein Schlusspunkt. Doch schaut man genau hin, dann fällt auf: der 13. Band ist noch nicht einmal geschrieben. Ein Gespräch über die Herkunft, das literarische Leben und die Bedeutung der Literatur.
Sehr geehrter Herr Geiser, Sie sind Schriftsteller, haben auch bereits früh erste literarische Unternehmungen veröffentlicht und zurzeit arbeiten Sie gemeinsam mit dem Secession Verlag an Ihrer Werkausgabe. Das erscheint ebenso erstaunlich wie aufregend. Denn fragt man heute nach dem Namen Christoph Geiser, dann wird das Echo eher flach ausfallen. Also lieber Herr Geiser möchte ich Sie bitten, sich einmal vorzustellen, und ebenso fragen, wer sind Sie?
Ich bin kurz nach dem zweiten Weltkrieg im Jahre 1949 in Basel geboren, gehöre demnach einer älteren Generation an. Geboren wurde ich in eine sehr bürgerliche Familie, die von Deutschland aus gesehen anachronistisch wirken muss. Familien dieser Art haben den Krieg in Deutschland nicht überlebt, genauer, diese Strukturen haben den Krieg nicht überlebt. Meine Mutter hatte zuvor eine Schauspielausbildung und -karriere begonnen, folgte Ihrem Vater, der in Berlin Schweizer Botschafter war, nach Deutschland bis die großen Flächenbombardements anfingen. Zurück in Basel fand sie nicht wieder in das Schauspielleben zurück, wurde Hausfrau und eine eher erfolglose Malerin. Mein Vater war Kinderarzt, der aus einer ganz anderen Familie stammte. Seine Mutter war russische Jüdin, die in Basel Medizin studierte, dann aber in der Schweiz psychisch krank wurde. Ich bin aufgewachsen mit den Gedichtrezitationen meiner Mutter, einerseits. Sie hat in mir den Grund gelegt für das Interesse an Literatur. Andererseits bin ich mit dem politischen Bewusstsein groß geworden, das durch den Krieg gegeben war. Hinzukommt, dass ich das Humanistische Gymnasium besucht habe, wo ich nicht sehr glücklich war, was nicht am Stoff, sondern daran lag, dass es eine anachronistische Schule in den 60er Jahren war, die nicht recht den Anschluss an die Zeit fand. Doch habe ich dort Latein, Griechisch und Hebräisch gelernt. So war die Literatur das eine, das andere war dann natürlich die Politik der Sechziger Jahre. Mein Nachhilfelehrer, der mir Mathematik hätte beibringen sollen, mit dem ich mich aber über anderes unterhalten habe, legte mir mal einen Band Brecht-Gedichte unter den Weihnachtsbaum, weil er fand, Rilke sei nichts für mich. Ein Mann der ein Leben lang mit verschiedenfarbigen Tinten Briefe an Hohe Damen geschrieben habe, das sei nichts für einen jungen Mann von heute – und Brecht war eine Initiation in die Literatur, überhaupt in die Verbindung von Literatur und Politik. Das ging gerade so weit, dass ich mich äußerlich auch auf Brecht stilisiert habe, also mit dem Kurzhaarschnitt, der Lederjacke und der Mütze. Und so war für mich die Literatur immer der Boden meiner Existenz, also wenn Sie mich fragen: Wer bin ich? – ich bin identisch mit meiner Literatur und mit der Literatur überhaupt.

Sie haben 1967 in Freiburg im Breisgau begonnen Soziologie zu studieren, was sie abgebrochen haben. Dann gründeten Sie 1968 den drehpunkt – eine literarische Zeitschrift – gemeinsam mit Werner Schmidli. Was hat Sie zu diesen Schritten bewogen?
Das Studium war nicht das richtige. Der Moment war aber auch nicht passend. 1968 in Freiburg, da konnte man nicht studieren, da konnte man nur demonstrieren. Ich bin dann sehr abrupt auf eine Nordland-Reise gegangen. Der Auslöser dafür war ein sehr ausführlicher Brief von Hans Bender, der darin meine Einreichungen für die Akzente abgelehnt hatte. Als ich dann zurückkam, wusste ich: Ich steige aus dem bürgerlichen Leben aus. Und wurde dann mithilfe von persönlichen Kontakten Journalist zuerst beim Zeitdienst von Theo Pinkus, einem bedeutendem Zürcher Buchhändler, dann bei der Neutralität und dem Schweizer Vorwärts. Das habe ich bis etwa 1978 gemacht. Dann entschied ich, mich als freier Schriftsteller zu verselbstständigen. Richtig ist, dass Werner Schmidli und ich in dieser Zeit den drehpunkt herausgegeben haben. Der drehpunkt entstand aus einer literarischen Gruppe. Wir – das waren Ueli Kaufmann, Werner Schmidli und ich – hatten damals eine Buchhandlung in der Straße in der ich aufgewachsen bin, die Buchhandlung Blum. Die lag am Basler Totentanz in St. Johanns Vorstadt, weshalb wir uns die Gruppe Totentanz nannten. Diese Gruppe bestand etwa vier Jahre von 1966 bis 1970. Bei Herrn Blum haben wir unsere Bücher gekauft und die Idee gewonnen, dort auch Lesungen zu veranstalten. Die Texte, die dort präsentiert wurden, es waren zum Teil junge Autoren, neue Autoren, wollten wir auch publizieren. So ist der drehpunkt entstanden. Die Redaktion des Hefts machten vor allem Werner Schmidli und ich. Und diese Redaktionssitzungen gingen so: Wir bekamen Manuskripte und jeder nahm sich einen Packen und schrieben drauf, was er wie fand. Dann fuhren wir in eine Gartenwirtschaft, entweder in Baselland oder im Elsass, und bestellten einen Liter Weißwein und einen Papierkorb, und dann gingen wir Text für Text für Text durch. Das haben wir zehn Jahre gemacht.
Bis etwa 1978 haben Sie also den drehpunkt herausgegeben. Dann haben Sie sich entschieden, freier Schriftsteller zu werden – was hat Sie zu dieser Entscheidung bewegt?
Ich gehörte damals zu der Familie der Schweizer Autoren. Das erste Büchlein ist 1968 erschienen. Mitte der 70er Jahre wurde mir der große Romanstoff fassbar. Und von dem Augenblick an, an dem ich angefangen habe, diesen Romanstoff zu entwickeln, habe ich den Journalismus immer mehr abgebaut und den drehpunkt abgegeben. Dank des Basler Schriftstellerkollegen Werner Schmidli kam ich darauf zum Benziger Verlag, wo die ersten beiden Familienromane erschienen sind, also Grünsee und Brachland, die sehr wahrgenommen wurden. Außerdem lernte ich dort Renate Nagel als Lektorin kennen, die sich 1983 mit Judith Kimche selbstständig machte. In deren erstem Programm war ich dann mit der Wüstenfahrt dabei. Und dann kamen in regelmäßigen Abständen die Romane bei Nagel & Kimche. Der Höhepunkt würde ich sagen, das war der Roman Das Gefängnis der Wünsche – das kommt jetzt im Herbst – der Roman bei dem ich versucht habe, Marquis De Sade und Goethe zusammenzubringen. Der wurde auch im Literarischen Quartett besprochen, wo ihn Reich-Ranicki gelobt hat, und das führte zum verkaufsmäßigen Höhepunkt.
Sie sprechen von einem Höhepunkt. Wie sind sie mit dem Fall umgegangen? Gab es für Sie Momente, in denen Sie dachten, ich höre auf?
Die Buchhändler haben bestellt, bestellt, bestellt und man hat auch entsprechend gedruckt, doch dann ist alles wieder zurückgekommen, weil sie es doch nicht verkauft haben. Es war wohl zu schwierig, aber vielleicht war ich auch beim falschen Verlag, was kein Vorwurf an Frau Nagel ist, aber wäre ich bei Suhrkamp gewesen, dort hätte man das wahrscheinlich besser repräsentieren können. Die Literatur bei meinem Verlag war einfach ein bisschen zu Schweiz orientiert und ein bisschen, wenn man will, zu brav. Mit dem danach folgenden Roman Kahn, Knaben, Schnelle Fahrt brachen die Verkaufszahlen ein. Das hatte aber viele Gründe. Ein Grund war natürlich auch die schon mit der Wüstenfahrt offengelegte Homosexualität. Dadurch habe ich einen Teil meiner Leserschaft verloren. Zwar habe ich welche hinzugewonnen, die konnten den Verlust aber nicht kompensieren.
Und dennoch war immer klar: Aufhören geht nicht. Das kam überhaupt nicht infrage. Und die wirklich schwierige Zeit, war die Zeit, da ich keinen Verlag mehr hatte. Ich schreibe ja nicht für mich und ich schreibe nicht im luftleeren Raum, sondern literarisches Schreiben ist für mich eine Form der Kommunikation. Und das bedeutet, dass ich natürlich Resonanz will, dass etwas zurückkommt. Und das war die schwierigste Zeit für mich, wenn nichts mehr zurückkommt – als ich das Gefühl hatte, ich bin in einem luftleeren Raum. Ich habe das im Jahr 2018 in meiner Dankesrede für den großen Berner Preis beschrieben, den ich sehr überraschend gewonnen habe. Dort ging es genau darum: um den Luftleeren Raum und den Wunsch nach Resonanz.
Herr Geiser, Sie haben nun selbst bereits auf einige der unterschiedlichen Verlage hingewiesen, in denen Sie untergekommen sind, sie haben die schwierige Zeit ohne Verlag benannt. Schaut man in Ihre Veröffentlichungsgeschichte, dann fällt besonders auf, dass Sie von 1977 an für etwa zehn Jahre auch in Ostdeutschland beim Volk und Welt Verlag Ihre Werke parallel unterbringen konnten – wie sind Sie dort gelandet? Und welche Verbindung haben Sie dorthin gehabt?
Erstens ich war ja Kommunist. Für mich war die DDR eine mögliche, eventuelle Alternative, eine Utopie. Nicht die Sowjetunion, aber das andere Deutschland als eine Möglichkeit, das war das eine. Das andere war, dass ein Schweizer Journalist, der unter dem Namen Jean Villen geschrieben hat, in die DDR ausgewandert ist. Und der hat sich dort auch darum bemüht, Schweizer Literatur zu vermitteln. Er war selber bei Volk und Welt und es hat sich erwiesen, dass die Schweizer Literatur in der DDR die beliebteste Literatur war und die Literatur, die am wenigsten Schwierigkeiten machte oder hatte – und zwar deshalb, weil sie nicht belastet war durch das deutsch-deutsche Verhältnis und weil sie in gewisser Weise gesellschaftskritisch war. Ich selbst war ja hier in Westberlin zwei Jahre, 1983–85. Zunächst mit einem DAAD-Stipendium des Berliner Künstlerprogramms, und dann habe ich von mir aus noch ein Jahr drangehängt in Westberlin. Am Anfang bin ich jede Woche einmal rüber zu Fuß über den Checkpoint Charlie. In Ostberlin hatte ich literarische Bekanntschaften und ich habe dort Lesungen gemacht. Und das ging dann soweit, dass mich einmal einer dieser Grenzbeamten gefragt hat: Haben sie denn eine Freundin bei uns? Die hatten Angst, ich solle geheiratet werden. Das war nicht so. Ich hatte dann auch Beziehungen zu der Schweizer Botschaft in Ostberlin, der erste Botschaftsangestellte, der hat Lesungen organisiert in seiner Wohnung – das war im Grenzbereich des Kritischen. Es war selbstverständlich überwacht.
Dann kam Christa Wolf ja nach Bern. Da habe ich sie in Bern betreut sozusagen und wir kommen dann beide in meiner Geheimdienstakte der Schweiz vor – ich habe auch zwanzig Jahre Bespitzlung von der Schweiz erfahren, nicht von der Stasi. Und – eine Klammerbemerkung – es gibt von der Christa Wolf einen Band, der heißt Ein Tag im Jahr, in dem hat sie immer einen Tag im Jahr über 40 Jahre lang genau protokolliert, es ist der 27. September, und ausgerechnet ich war an einem solchen Tag bei ihr, sie hat mir Rendezvous gegeben, und deshalb ist dieser Besuch ausführlich protokolliert. Und dort steht auch, dass sie es gemerkt hatte, wenn ich nervös wurde, wenn es gegen Mitternacht geht, weil ich immer Angst hatte, ich komme nicht mehr rüber und sie behalten mich – was ich nie wollte. Ich wollte zurück in mein Freigehege Westberlin, in dieses Bordell zurück.
Nach Nagel & Kimche sind Sie beim Ammann Verlag erschienen. Wie kam es zu diesem Wechsel und wie haben Sie das plötzliche Ende bei Ammann erlebt?
Vor ab muss ich sagen, Nagel & Kimche und vor allem Frau Nagel, das war mein Verlag. Hätte sie nicht verkauft und hätten die Nachfolger mich nicht verstoßen, wäre ich bei Nagel & Kimche geblieben. Der Nachfolger wollte mich nicht, weil ich eine Altlast war. Das hatte Gründe, aber er hat vor allem auf andere, auf jüngere Literatur gesetzt und ein bisschen auf den Unterhaltungsbereich. Und dann war ich eben wirklich eine Alt-last. Er wollte im Grunde die alten Autoren von Frau Nagel loswerden und die eigenen jungen Autoren fördern. So kam ich nach einiger Zeit zu Ammann. Egon Ammann war jemand, der einem immer das Blaue vom Himmel versprochen hat. Ich hätte auch nie gedacht, dass er aufhört, aufhören muss. Und das war in gewisser Weise genauso unangenehm, wie das Ende bei Nagel & Kimche. Auch wenn es nicht so lange gedauert hatte und auch wenn mein literarisches Verhältnis zu Egon Ammann nicht so eng wie zu Frau Nagel war – Renate Nagel hat sich wirklich in die Bücher hineingekniet, das ging auch an die Grenzen, also das waren häufig Lektoratsschlachten. Und der Egon Amann, ich war mir nicht einmal sicher, ob er die Bücher überhaupt gelesen hat. Ja, man war immer sein Freund, der große Freund und so, aber wir haben uns nicht über Literatur unterhalten. Das war doch ein bisschen merkwürdig. Dann ging es plötzlich vorbei. Ich musste natürlich irgendwie einen neuen Verlag suchen und auch finden. Das sind die unangenehmsten Momente: Alle möglichen Versuche machen, Briefe schreiben, keine Antworten bekommen oder seltsame Antworten. Ich habe es dann einmal versucht mit einer Agentin in Bern, aber das hat überhaupt nicht funktioniert.
Und wie ging es danach für Sie weiter?
Dann kam ich durch Zufall an einen Verleger, der aber eigentlich kein literarischer Verleger ist. Dieser Verlag ist dann auch geschlossen worden. Da ist ein Buch erschienen, die Schöne Bescherung, die jetzt in der Werkausgabe vorgezogen ist. Die hätte natürlich sehr gut zu Ammann gepasst, nachdem er ja schon Grünsee und Brachland in einem Band veröffentlicht hatte. Das wäre wie eine Vignette, wie ein Abschlussband dazu gewesen – danach war wieder gar nichts. Doch habe ich dann etwas entdeckt, von dem ich gar nicht wusste, dass es mich interessiert, nämlich die Mordsachen, das Genre True Crime. Ich bin da aus literarischen Gründen auf eine Geschichte gestoßen, die sich von selber geschrieben hat. Und so haben sich zwei weitere Geschichten ergeben und damit wollte ich eben irgendwie versuchen, mit dieser Agentin aus Bern irgendwo unterzukommen – das ging überhaupt nicht. Und dann hat mein Bruder, der eher mit Film zu tun hat, mir den Kontakt zu einem Cineasten vermittelt, der experimentelle Filme macht und in der Schweiz bekannt ist, Clemens Klopfenstein. Er lebt in Umbrien und schreibt selber und hatte auch ein Buch parat über seine Filme. Er wollte sich aber nicht einfach nur selber publizieren, weshalb er einen kleinen Verlag gegründet hat, Die Lunte. Eines Nachmittags kam er zu mir und ich habe ihm das Manuskript gegeben. Am anderen Morgen rief er mich an, er habe es bis vier Uhr gelesen und habe so lachen müssen, das mache er! Und dann haben wir zusammen mit noch einem Freund eine Reihe veröffentlicht, die es immer noch gibt. Gesagt werden muss aber, das ist kein professioneller Verleger, dennoch bin ich ihm dankbar, dass er so spontan reagiert hat, das war ich nicht gewohnt. Und dann war einfach wieder überhaupt nichts mehr. Also ich dachte, ich mache vielleicht wieder mit ihm etwas, wenn es nichts anderes gibt. Aber dank des Berner Vermittlers, Hans Rupprecht, bin ich zu Christian Ruzicska zum Secession Verlag gekommen. Das war dann wirklich plötzlich ein wunderbarer Neuanfang.
Und eben genau dort wird jetzt nach und nach Ihre Werkausgabe erscheinen. Wie fühlt es sich für Sie an, diese späte Aufmerksamkeit und Anerkennung für Ihr Schaffen zu erhalten? Und stand der Beschluss über die Werkausgabe bereits fest, bevor Sie 2019 Ihren vorerst letzten Erzählband Verfehlte Orte dort veröffentlicht haben?
Die zweite Frage kann ich ganz klar mit nein beantworten. Das stand zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Und das erste ist überhaupt ein Wunder, dass das zustande kommt. Die Personen, die sich da zusammengefunden und entschieden haben, das zu machen, das ist eine so ideale personelle Kombination. Das Unternehmen ist kühn und es ist natürlich eine große Befriedigung, dass ich sehe, das ist ein Lebenswerk. Ich habe nie einzelne Bücher geschrieben, ich habe das immer als Werk verstanden, das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass ich mir selber wieder begegne. Natürlich waren die Bücher immer irgendwie präsent, aber ich habe mich nicht mehr damit auseinandergesetzt. Und das jetzt erzeugt den Vorgang einer Bilanz. Dass ich auch das ganze überblicke, also: Was habe ich eigentlich gemacht? – Sie haben mich am Anfang gefragt, wer bin ich? Also woher komme ich und wohin geht das? Denn der letzte Band ist ja noch gar nicht geschrieben ist. Den muss ich noch schreiben, den 13. Band.
Und warum haben Sie entschieden, mit den zwei Familienromanen zu beginnen? Beide stehen ja nicht am Anfang ihres schriftstellerischen Schaffens.
Warum wir mit Grünsee und Brachland angefangen haben? Im Prinzip wollten wir ja chronologisch vorgehen und eigentlich ist Grünsee der wirkliche Anfang. Ich kann sagen, was vorher ist, das ist wie einen Anlauf nehmen zu diesem ersten eigentlichen Roman. Es gab einen Vorläufer, das ist Zimmer mit Frühstück. Das ist eine lange Erzählung oder früher nannte man so etwas einen Kurzroman. Aber mit dem anzufangen, kam nicht infrage, denn er ist zu schwierig, aber auch zu abseitig. Der wird im Erzählungsband kommen. Im Grunde ist Grünsee also der Anfang gewesen. Zu dieser Zeit war ich das erste Mal bei einem größeren Verlag, eben bei Benziger, mit einem seriösen Lektorat durch Frau Nagel, und abgesehen davon, und das habe ich jetzt auch beim Wiederlesen so empfunden, es ist ein starkes Stück. Es ist der Typhus, es ist diese Familiengeschichte, es ist dieser Selbstmord und es ist das Matterhorn und die Zermatter Landschaft. Dieses ganze Buch hat einen Zug, eine Dramaturgie. Ich habe immer das Gefühl, es ist noch fast eher eine Novelle als ein Roman, es hat eine Katharsis am Schluss und dieser Selbstmord ist das Ereignis, das ja das ganze auslöst. Brachland dagegen ist breiter, dennoch gehören beide Romane zusammen. Und die Schöne Bescherung, das ist ein Schlusspunkt, der Familiengeschichte. Ich habe mich manchmal gefragt, ob es sinnvoll war, die Schöne Bescherung vorzuziehen, weil die Leute die mich nicht kennen, dadurch das Gefühl bekommen, er hat seine Familiengeschichte nie verlassen. Und das stimmt natürlich nicht, denn mit Wüstenfahrt und dem was dazwischen ist, kommt eben der Ausbruch. Die Schöne Bescherung ist dann wie eine Rückkehr, vielleicht auch das Eingeständnis des Scheiterns des Ausbruchs. Da geht es auch um den Tod. Aber wahrscheinlich ist es schon richtig gewesen, da es thematisch schon sehr dazu gehört. Außerdem bin ich froh, dass der Text da ist, weil diese Schöne Bescherung so untergegangen ist in dem falschen Verlag.
Schauen wir noch einmal zurück, dann sehen wir, dass Sie Anfang der Neunziger Jahre Ihre Materialien in das Schweizer Literaturarchiv gegeben haben. Sie sagten, dass Sie nie ans Aufhören gedacht haben, was hat dann die Entscheidung dazu beeinflusst? Wollten Sie einen Teil von sich konservieren, in gewisser Weise abschließen?
Ums Abschliessen ging es mir sicher nicht. Meine erste Reaktion als dieses Literaturarchiv gegründet wurde, war, ich kann jetzt endlich Platz schaffen. Ich muss nicht entscheiden, was ich wegwerfe, was ich behalte. Ich gebe das dem Literaturarchiv, die nehmen mir das ab, dort ist es dann gut aufbewahrt. Denn ich habe einen gewissen Hang zum Messi, ich bewahre sehr vieles auf. Das ist wie mit der Werkausgabe, das ist einfach gelebtes Leben, das mit der Literatur zu tun hat. Und dann habe ich einmal ein Gespräch angeboten mit dem damaligen Leiter des Archivs und die hatten so komisch reagiert. Es sei eigentlich nicht ihre Aufgabe Literatur zu unterstützen, das sei Aufgabe der Pro Helvetia. Die glaubten, ich würde das verkaufen wollen. Ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Im Nachhinein habe ich erfahren, die meisten Autoren haben verkauft. Das war eine Möglichkeit, sich zu finanzieren, indem sie ihre Materialien verkauft haben. Aber daran dachte ich überhaupt nicht. Ich habe ja meist wirklich sehr gut gelebt mit Unterstützung der Pro Helvetia und Stipendien, vor allem auch Auslandsstipendien. Mit dem Archiv gibt es einen Schenkungsvertrag, in dem geregelt ist, dass ich laufend einliefern kann. Wenn ein Stoffkomplex fertig ist, dann wird er eingeliefert. Natürlich erschwert das ein bisschen die Arbeit der Archivare, weil diese Nachlieferungen einen endgültigen Abschluss verzögern, der kommt erst, wenn ich tot bin. Aber ich bin sehr froh, dass das geklappt hat. Es ist für mich wichtig und es gehört auch zur Werkausgabe die Frage, was bleibt? Dass zum Schluss nicht einfach die Mulde oder der Container kommt und alles wird weggeworfen. Und jetzt seit ein paar Wochen ist mein Archiv sogar online geschaltet. Sie können also sehen, was da alles drin ist.
Wenn Sie nun nach vorne schauen, was wünschen Sie sich von der Literatur?
Literatur darf nicht starr sein. Es gibt nicht irgendwelche starren Vorstellungen. Ich habe eigentlich zwei Wünsche. Erstens, dass die Literatur sich wieder darauf konzentriert, dass sie Sprache ist, dass die Autoren und Autorinnen Sprachbewusstsein, verstärkt Sprachbewusstsein entwickeln, und auch innovatives Sprachbewusstsein. Die Sprache ist unser Instrument, ist unser Material, und dass das wieder bewusster wird. Das ist das eine. Und das andere, dass man die Traditionen nicht vergisst. Ich bin nicht rückwärtsgewandt. Also man muss nicht schreiben wie der oder die, aber dass man die Traditionen kennt, dass die nicht verloren gehen. Das geht wieder ins gleiche Archiv-Denken, Werkausgabe-Denken, dass im Grunde derjenige, der schreibt, auch immer erst einmal ein Leser ist, und dass das Bewusstsein bleibt, dass man uns nicht vergisst, die die vorher geschrieben haben.
Das Titelbild zeigt das Elternhaus von Christoph Geiser, aufgenommen wurde das Foto für das Interview von Simon Morgenthaler / privat