Von Pascal Mathéus und Larissa Plath
Das erste Gespräch zur Rettung der Literaturkritik in der Aufklappen-Reihe Kritik der Kritik der Kritik
Stefan Gmünder lebt seit vielen Jahren in Wien und arbeitet dort als Literaturkritiker. In diesem Jahr wurde er mit dem österreichischen Staatspreis für Literaturkritik ausgezeichnet. Der zeitgenössischen Literaturkritik fehle es vor allem an Vertrauen, findet Gmünder. Vertrauen von Redaktionen und Vertrauen in die Kraft der Literatur. Im Interview mit Aufklappen erzählt er, was Literatur und Fußball gemeinsam haben und von dem größten Lob, dass er je für seine Arbeit bekommen hat.

Aufklappen: Wann war der Zeitpunkt, an dem Sie gemerkt haben: Jetzt bin ich ein Literaturkritiker?
Gmünder: Eine schwere Frage. Man bildet es sich ja eigentlich immer von Anfang an ein, dass man es wäre. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich es jetzt noch nicht richtig bin. Bis sich eine gewisse Routine einstellt, dauert es sehr lange, bei mir waren es sicher zehn Jahre. Ich glaube, dass das ein Beruf ist wie die Schriftstellerei, bei der man auch immer Anfänger bleibt.
Haben Sie zwischen Literaturkritiker und Redakteur oder Journalist im Kulturbereich unterschieden?
Habe ich eigentlich nicht. Ich habe von Anfang an fast nur Kritiken geschrieben. Fürs Tagesaktuelle habe ich dann erst später gearbeitet und meinen Beruf deshalb immer schon als den des Kritikers verstanden. Es ist eine journalistische Form, aber eine Form, die sehr aufmerksam mit Sprache umzugehen hat. Es ist ein Handwerk, das man nur dadurch erlernt, dass man viel schreibt. Vielleicht schließt das an die Anfangsfrage an: Erst wenn man dieses Handwerk durch viel Schreiben gelernt hat, könnte man sich einbilden, ein Kritiker zu sein. Es hat jedoch nichts mit der Menge an Rezensionen zu tun, sondern mit einem inneren Prozess der wachsenden Zuversicht und vielleicht auch der Gelassenheit.
Weshalb wollten Sie Kritiker werden? Und was haben Sie dafür unternommen?
Es gab da eine Affinität zur Literatur und einen Glauben an die Literatur, die für mich immer ein Umgehen mit Abweichungen war. Ich habe erst spät zu lesen begonnen, dann aber sehr begeistert, weil ich gemerkt habe, dass Literatur dem Leben etwas hinzufügt und nicht wegnimmt. Es hat mit anderen Leben, Regionen oder Geschlechtern zu tun, die man leben könnte. Damit war entschieden, dass ich Rezensionstexte anbieten möchte, nicht journalistische Texte. Über viele Umwege kam ich dann relativ spät dahin. Ich habe vorher auch andere berufliche Wege verfolgt. Irgendwann war mir jedoch klar, dass es um Literatur gehen muss.
Ich verstehe Literaturkritik vor allem als Hinweis auf etwas, was dieses oder jenes Buch deinem Leben hinzufügen kann.
Was waren das für erste Lektüren? Gibt es da etwas, was bis heute geblieben ist?
Viele verachten die Bücher, die ich damals las. Ich habe Philippe Djian gelesen – Betty Blue ist eines seiner bekanntesten Bücher, das auch verfilmt worden ist. Erogene Zonen und Verraten und Verkauft sind zwei weitere Titel, die zu einer Trilogie gehören. Ziemlich wildes Zeug. Diese Bücher habe ich in meiner Armeezeit auf der Wache gelesen. Sie erzählen eine Liebesgeschichte zwischen zwei jungen Leuten, die natürlich schlecht ausgeht. Ansonsten viel Remarque, nicht Im Westen nichts Neues, sondern die anderen Romane, die zum Teil wahnsinnig kitschig, aber nicht schlecht sind. Und Fallada, den man jetzt wiederentdeckt und aus diesem Trivialliteratureck herausgehoben hat. Später las ich dann Hemingway, aber am Anfang vor allem Triviales.
Haben die Kameraden Sie auf der Wache in Ruhe lesen lassen?
Nicht immer. Es hat ab und zu Wickel gegeben. Eigentlich ist das da ja nicht zum Lesen gedacht. Das wurde ungern gesehen.
Sie haben von Umwegen und anderen Berufen gesprochen? Welche waren das?
Ich habe verschiedene Dinge gemacht. Vieles hatte weder mit Literatur noch mit dem Kunstbetrieb zu tun. Eines der Probleme war, glaube ich, dass ich nie ein richtiges Ziel verfolgt habe. Es war keine gerade Berufsbiographie. Das ging früher noch besser. In den 80er-Jahren gab es genug Jobs, man konnte dieses und jenes versuchen.
Würden Sie im Nachhinein sagen, dass es für die Literaturkritik geholfen hat, in andere Bereiche zu schauen?
Auf alle Fälle. Natürlich braucht es Rüstzeug aus der Germanistik oder aus anderen Literaturwissenschaften. Mein Zugang ist aber ein weitgehend unakademischer. Ich verstehe Literaturkritik vor allem als Hinweis auf etwas, was dieses oder jenes Buch deinem Leben hinzufügen kann. Das ist natürlich einerseits individuell, aber hinsichtlich der Möglichkeitsräume, die Literatur, wenn sie gut ist, erschließen kann, auch kollektiv. Um diesen Hinweis ging es mir immer – schon vom eigenen Leben her, das auch mit relativ vielen Problemen behaftet war. Umso wichtiger war für mich Literatur. Und sie ist es bis jetzt noch. Wenn das pathetisch klingt, ist es mir wurscht. Sie ist ein gewisses Überlebensmittel. Das war mir immer ein sehr wichtiger Punkt, den ich verfolgt habe.
Wir finden wichtig, dass Kritiker diese Position beziehen, weil sie sehr glaubwürdig ist. Wenn ein Kritiker sagt: Das hat etwas mit dem Leben, mit mir zu tun und es geht auch dich etwas an. Marcel Reich-Ranickis Beispiel steht da immer sehr prominent vor Augen – seine Biographie und der Stellenwert, den Literatur darin gespielt hat. Seine Frau Teofila hat ihm im Warschauer Ghetto die Gedichte von Kästner abgeschrieben und geschenkt. Und an diesen Gedichten haben sich die beiden festgehalten, um zu überleben. Dass Literatur so etwas kann, imponiert uns sehr. Es gibt ja auch die Idee, dass Kunst überhaupt immer mit Leiden zu tun habe. Trifft das auf die Literatur zu? Spricht sie besonders zu Menschen, die auf irgendeine Weise Leid erfahren haben?
Ich glaube das auf jeden Fall, weil zumindest die Literatur, die ich mag und die mir nahe ist, von Menschen geschrieben wird, die solches erfahren haben. Man spürt es, wenn man sie liest, oder auch in ihren Poetikvorlesungen, oder wenn man sie im Interview hat – das war bei Bernhard so, bei Vargas-Llosa ebenfalls. Vielleicht nennen wir es nicht „leiden“, sondern einen Mangel, eine Unzufriedenheit mit dieser Welt oder eine Ausgesetztheit in dieser Welt, der man ästhetisch etwas entgegenstellt. Nicht eine Geschichte, aber eine Form. Man baut mit Sprache eine neue Welt. Ich glaube, dass das bei den meisten Autoren so ist. Bei Hölderlin, bei Büchner, Dostojewski, Gogol; Camus hat darauf hingewiesen, auch Hemingway. Oder nehmen wir die aktuelle Literatur von Migranten: Oft ist auch da eine existentielle Geschichte dahinter, mindestens in der vorherigen Generation. Man könnte sagen, bei Proust ist es anders. Der war immer wohlbehütet, hatte viel Geld. Aber geht es bei ihm nicht auch um einen Mangel? Sein Werk ist geprägt durch den Versuch, diese Kindheitswelt, das Aufgehobensein zu rekonstruieren, dem nachzujagen über viele Seiten. Ich glaube, das ist eine der Grundfeste der Literatur. Und somit auch des Lesens. Warum ist man denn Leser geworden? Das ist wohl für jeden eine ähnliche Geschichte. Selten hat sie mit Zwang zu tun und nie mit irgendwelchen Regeln. Sondern einfach mit einer Begeisterung, mit etwas, das einen einmal tief berührt hat. Wenn sie es dir in der Schule nicht ausgetrieben haben, dann bleibt man nachher Leser.
Ist es Ihnen einmal gelungen, diese Begeisterung zu übertragen?
Das größte Lob, das ich einmal bekommen habe, war bei einer Veranstaltung in Wien, die ich moderiert habe. Es war im Jänner, draußen 15 Grad minus, da kamen ein paar Obdachlose – Sandler sagen sie hier in Wien – herein, um sich aufzuwärmen. Sie haben sich das angehört, Einleitung, Lesung und Gespräch, dann war es endlich fertig und am Ende kam einer von denen auf mich zu und hat gesagt, das haben Sie gut gemacht. Der war bloß da, weil er es warm haben wollte und hat plötzlich gemerkt: Das was hier verhandelt wird, hat mit mir zu tun.
Eine gute Geschichte über die Kraft der Literatur, die sich nur mit Freiwilligkeit verträgt. Eigentlich das Gegenstück zur Geschichte von Friedrich Merz, der dem Obdachlosen, der sein Laptop gefunden hat, sein Buch schenkte, was dieser in die Spree warf. Zwangsbeglückung funktioniert nicht.
Ja, genau.
Wie schafft man es, im Alltagsgeschäft der Literaturkritik immer wieder als Leser mit Begeisterung und Leidenschaft an die Sache heranzugehen?
Das Hauptproblem ist, dass man keine Zeit hat. Wenn man sich die Zeit nimmt, wird man schnell zu einer lächerlichen oder altmodischen Figur. Das Problem ist die Geschwindigkeit, mit der mittlerweile Bücher rezensiert werden müssen. Damit kämpfen viele, glaube ich. Es kommt zu schnell immer das nächste. Viele Kritiker, die älter werden, ziehen sich ein wenig zurück und machen nicht mehr so viel. Bei Karl-Markus Gauß hat man das gesehen, bei Andreas Breitenstein, am deutlichsten bei Thomas Steinfeld. Es ist eine der großen Herausforderungen, das Bewusstsein aufrecht zu erhalten, dass man immer mit einem neuen Buch umgeht, dass es um die Auseinandersetzung mit einem Text gehen soll und nicht nur um eine weitere routinierte Auftragsarbeit.
Haben Sie Ideen, was nötig wäre, damit das besser liefe? Oder muss man die Waffen strecken vor dem Geschwindigkeitsgebot und der riesigen Anzahl an Büchern, die jedes Halbjahr erscheinen?
Man bräuchte ein redaktionelles Umfeld, in dem man einem vertraut und wo man mehr oder weniger machen kann, was man möchte. In der deutschsprachigen Belletristik sind es vielleicht 6.000 Bücher, die pro Halbjahr erscheinen. Es würde zu einem gewissen Berufsethos gehören, dass man sich über einen Großteil einen Überblick verschafft. Darunter habe ich am meisten gelitten. Zuerst habe ich es im Ganzen versucht, dann wenigstens die österreichische und schweizerische Literatur, dann war es irgendwann nurmehr Österreich. Eigentlich ist das nicht schlimm, aber es bleibt viel auf der Strecke. Der redaktionelle Druck hat unterdessen zugenommen. Es heißt: „Wir müssen das schnell haben“, „warum haben die anderen das schon“? Darum werden überall die gleichen Bücher innerhalb von drei Tagen besprochen.
Ein Stück weit kompensieren Blogs wie We read Indie oder Bookgazette diesen Umstand. Sie sind Jurymitglied bei der Hotlist der unabhängigen Verlage. Verstehen Sie ihre Aufgabe als Kritiker so, dass es darum geht, ein Gegengewicht gegen den Mainstream sein zu wollen?
Ich versuche es. Ich glaube schon, dass es dazu gehört. Es stimmt natürlich, dass man um Autorinnen und Autoren, die ein gewisses symbolisches Kapital haben, also bekannt sind, nicht herumkommt. Früher war das nicht so schlimm, weil Platz da war. Wenn der Platz jedoch geringer wird, kommt das andere kaum mehr vor. Die FAZ hat lange alle drei oder vier Wochen eine Seite gemacht, auf der sie sämtliche Neuerscheinungen abgebildet hat. Ich habe von vielen kleinen Verlegern gehört, dass denen das total getaugt hat. Ich dachte, das wäre eigentlich sinnlos und Platzverschwendung, aber es ist schon wichtig, dass die Bücher überhaupt irgendwo vorkommen – gerade für die kleineren Verlage, die sich jetzt zum Glück zu organisieren beginnen. Sie haben völlig zu Recht gesagt, dass auch die Blogs mittlerweile zum Teil ein Gegengewicht bilden, weil dort kleinere Verlage stärker wahrgenommen werden.
Umso wichtiger war für mich Literatur. Und sie ist es bis jetzt noch. Wenn das pathetisch klingt, ist es mir wurscht. Sie ist ein gewisses Überlebensmittel.
Die vermutlich sehr naive Idee von Aufklappen ist, die deutschsprachige Literatur in Gänze abzubilden. Wir fragen uns, was deutschsprachige Literatur insgesamt leisten kann. Natürlich ist das Wahnsinn, weil es niemand seriös machen kann – höchstens mit einer sehr großen Mannschaft. Immerhin gibt es ja so etwas wie die SWR-Bestenliste, die ein ganz gutes Instrument ist, um wenigstens eine Schneise zu schlagen. Dort kommen ja auch relativ oft Bücher aus kleinen Verlagen vor. Bei Aufklappen ist der Anspruch, das abbilden zu wollen, was wichtig ist. Die Frage, „was ist wichtige, was ist gute Literatur?“ droht unserem Gefühl nach angesichts der Vielzahl von Publikationen ein wenig zu verschwinden. Es ist ja nicht so, dass nicht viele interessante Rezensionen erscheinen würden. Was man aber ein Stück weit vermisst, ist der Überblick. Wer kann den geben? Was sollte Ihrer Meinung nach die Ausrichtung der Kritik sein? Mehr Konzentration, mehr Auswahl, oder sollte man noch mehr in die Breite gehen?
Ich denke, es wäre mehr Auswahl nötig. Man behauptet oft, es sei alles auswechselbar. Aber es gibt eben doch gewisse Autoren, an die man sich hält. Ich glaube nur über die Auswahl, die mit persönlichen Präferenzen verbunden ist, und zum Teil auch Abgelegeneres berücksichtigt, kann es gehen. Es muss der Anspruch sein, die Breite abzubilden und trotzdem auszuwählen. Es liegt ja auch in der Natur der Sache, dass von diesen 6.000 Titeln 4.000 nicht substantiell sind. Darunter das zu finden, was man für relevant hält, ist die Aufgabe.
Etwa zwei Drittel sind nicht relevant, sagen Sie. Maxim Biller sagt, man könnte auf 95% verzichten…
Ich wollte nur nicht so übertreiben. Wahrscheinlich hat er sogar recht. Das ist eine radikale Position, aber eben seine Einschätzung als Leser. Die mag man teilen, aber es gibt ja dann auch wieder Leserinnen und Leser, die es anders sehen und vielleicht Doris Knecht lesen. Dagegen kann man auch nichts haben. Es wird nur dann schwierig, wenn das als große Literatur dargestellt wird. Das heißt nicht, dass es schlechte Literatur wäre, aber unter den Prämissen, die wir am Anfang zu umreißen versucht haben, ist das dann eher nur eine Geschichte. Man liest auch in Verlagsvorschauen immer häufiger von Geschichten: „Dieses Buch erzählt eine Geschichte über…“. Das Leben schreibt aber keine „Geschichten über“, dafür ist es zu komplex. Wenn man eine gewisse Komplexität des Lebens, meinetwegen auch der Ästhetik, abgebildet sehen will, dann hat Biller wohl recht. Ohnehin habe ich den Eindruck, dass mittlerweile mehr geschrieben wird als gelesen.
Würden Sie an der Literaturkritik kritisieren, dass es heute zu viel um Inhalte geht? Dass auch in den Rezensionen zu wenig über Sprache und Stil geschrieben wird – die zugegebenermaßen auch schwieriger zu beschreiben sind?
Das finde ich schon. Es ist ja auch eine alte Leier. Klar ist das schwierig. Aber Literatur ist nicht aus Geschichten gemacht, sondern aus Worten. Literatur schafft zusätzliche oder alternative Realitäten, eine Form. Über die Form muss sie sich entwickeln. Es gibt gewisse Beispiele von sehr erfolgreichen Autoren, die meiner Meinung nach mit der Form spielen und trotzdem Inhalte rüberbringen, die relevant sind. Houellebecq wäre zum Beispiel so ein Autor. Es braucht das Bewusstsein, dass man als Schreibender mit Form zu tun hat. Nicht nur mit einer Alltagssprache, die natürlich dann auch wieder als Stilmittel eingesetzt werden kann. Ich glaube, dadurch entsteht Komplexität, die dann vielleicht nicht mehr so leicht zu schreiben ist und womöglich auch nicht so zugänglich.
Wenn 95% schlecht sind, müssten dann auch 95% Verrisse in der Zeitung stehen? Fehlen Verrisse insgesamt? Oder müsste man fast ausschließlich über die übrigen 5% schreiben und über den Rest nur, um exemplarisch zu zeigen, was Tendenzen sind, die es zu bekämpfen gilt?
Ich glaube, man müsste über die 5% schreiben. Nur hat Biller, das unterstelle ich ihm mal, natürlich auch die 6.000 Bücher nicht gelesen. Ich glaube, dass da auch wahnsinnig viel übersehen wird. Wenn man bei Kleinverlagen wühlen würde und sich die Zeit nähme, gäbe es da viel zu entdecken. Das Problem ist, dass Teile von den 95% in den Feuilletons auch noch hochgejubelt und nicht bloß als Phänomen beschrieben werden. Nehmen wir Fifty Shades of Grey oder Feuchtgebiete. Da könnte man phänomenologisch etwas machen. Aber wenn die in der FAZ oder der Süddeutschen auf einer ganzen Seite ernsthaft besprochen werden, dann wird es schwierig, finde ich.
Wenn du als Literaturbetrieb diese Überzeugung verlierst, dass wir etwas zu bieten haben – andere Welten und Lösungsansätze –, dann hast du aufgegeben.
Warum machen die das? Sie fügen der Kritik dadurch ja Schaden zu. Einfach, weil es Aufmerksamkeit erzeugt? Oder glauben die wirklich, dass das gute Literatur ist?
Wie Sie sagen, spielt das Inhaltistische eine Rolle. Mittlerweile wird Literatur über Themen verkauft oder extrem personalisiert. Da gibt es viele Beispiele, etwa Stefanie Sargnagel. Man kann grundsätzlich nichts dagegen haben. Solche Geschichten bringen Aufmerksamkeit, es gibt Auflage…
Fordert an dieser Stelle die alte Unterscheidung zwischen E und U wieder ihr Recht?
Ich glaube nicht unbedingt. Am Anfang habe ich von Djian, Remarque und Fallada gesprochen. Das ist eigentlich klassische U-Literatur. Fifty Shades of Grey ist hingegen Effektliteratur. Es wird ein Effekt hervorgerufen. Ein Bernhard und eine Jelinek funktionieren auch nicht viel anders, aber dann ästhetisch eben doch auf einem anderen Level. Wir drei könnten uns jetzt auch irgendetwas ausdenken und ein Buch schreiben, das fahren würde wie die Sau. Es muss nur abgedreht genug sein und gewisse Tabuthemen aufgreifen.
Das passt vielleicht auch zur Debatte um die Streichung von Literatur in den Medien. In der Diskussion über die Literaturkritik im Literaturhaus Köln war ein Ansatz, über Autorenpersönlichkeiten und über Themen Interesse zu wecken bei den Leuten, die sich nicht ohnehin schon für Literatur interessieren. Das Ganze soll dann noch in leicht verdaulichen Häppchen serviert werden…
Klar kann es so funktionieren: Mein Ex-Schwiegervater, der sonst überhaupt nicht gelesen hat, kaufte sich Feuchtgebiete sofort. Ich weiß nicht, ob er es gelesen hat, aber er hat einfach gesehen: Da ist was los. Ich glaube aber nicht, dass es das sein kann. Es geht um Überzeugung. Wenn du als Literaturbetrieb diese Überzeugung verlierst, dass wir etwas zu bieten haben – andere Welten und Lösungsansätze –, dann hast du aufgegeben. Jetzt, wo die Anliegen der LGBTQ-Bewegung überall verstärkt zu hören sind, könnten wir doch sagen, dass es in der Literatur immer schon um Abweichung ging. Dass auf diese Weise aus Schwäche Stärke gemacht werden kann, aus Unzugehörigkeit Zugehörigkeit, und aus einem Windhauch ein Sturm. Das muss man gespürt haben. Es ist wie im Fußball. Man kann das nicht „nahebringen“, man muss es selber erfahren. Das Vertrauen darauf, dass die Menschen das auch erfahren wollen, sollte man schon haben. Alles andere ist zynisch. Die Zugänge vieler im Kulturbetrieb sind mittlerweile einfach zynisch.
Gut, dass wir zu dem Punkt kommen, an dem wir fragen, welche Verantwortung Kritikerinnen und Kritiker an der schwindenden Relevanz von Literaturkritik tragen. Eine These wäre, dass Kritikern heute selbstverschuldet die Autorität fehlt. Die Leute wissen ja, dass ein Kritiker diese 6.000 Bücher eh nicht überblicken kann. In vielen Kritiken wird auch nicht mehr gesagt, ob da ein gutes oder schlechtes Buch vorliege, sondern es wird versucht, auf komplizierte Weise zu erklären, was dieses schwer bestimmbare Andere ist, über das wir vorhin gesprochen haben. Viele Leserinnen und Leser haben dann das Gefühl, dass das im Grunde Geschwurbel sei – „deutsche Kritiker haben Gulasch im Kopf“, sagt etwa Maxim Biller. Und auf Hubert Winkels jüngste Grundsatzrede gab es – gerade auch von anderen Kritikern – die Reaktion, das sei doch abgehoben und viel zu kompliziert, um irgendjemanden zu erreichen. Wir fragen uns, ob es Literaturkritikerinnen und -kritikern deshalb an Autorität fehlt, weil sie gar keine Autoritäten mehr sein wollen. Indem sie sagen, es ist eigentlich viel zu viel Literatur da, und wir wollen auch keine Richter sein, sondern mehr Vermittler und Erklärer. Die Leser, die nicht aus dem Betrieb kommen und sich den ganzen Tag mit Literatur beschäftigen, wollen aber jemanden, dem sie vertrauen können, dessen Wort Gewicht hat. Eine Autorität, der man Glauben schenkt – oder aber auch um gegen eine solche Autorität aufzubegehren.
Wahrscheinlich schon. Die Rede Winkels ist aber eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es das doch vielleicht noch gibt – gerade weil er auch auf Contra stößt. Winkels hat ja immer wieder solche Grundsatzreden gehalten. Insgesamt ist es wahrscheinlich nicht mehr die Zeit der Autoritäten. Als Reich-Ranicki groß wurde, bestand das Programm von Suhrkamp vielleicht aus acht oder neun Autoren – Frisch, Walser, Enzensberger, Nizon, Beckett, Cortázar und noch ein paar andere. Ohne einen Überblick zu haben, kannst du keine Autorität sein. Ich habe viele Diskussionen mit unbekannteren Autoren geführt, die einfach nicht das Glück hatten in größeren Zeitungen vorzukommen. Zum Teil konnte ich etwas machen, zum Teil auch nicht. Wenn man aber nichts macht – sei es aus Arbeitsüberlastung oder weil etwas anderes Priorität hat–, dann bist du eben keine Autorität.
Interessant! Es wäre jetzt zu fragen, wie Macht und Autorität zusammenhängen und ob das eine ohne das andere geht. Es stimmt ja, dass dieser Ausstoß an Neuerscheinungen nicht mehr zu überblicken ist, aber darf man sich deshalb zurückziehen? Wir hätten den Wunsch, dass Kritiker stärker hervortreten und etwa sagen, „hier sind meine zwanzig Autoren, die ich wichtig finde“, oder „hier sind dreißig Bücher, die in meinem Leben eine besondere Rolle gespielt haben“. Man denke da an Joachim Kaisers Erlebte Literatur oder Marcel Reich-Ranickis Geschichte der deutschen Literatur. Natürlich hatten es die beiden einfacher, weil der Markt übersichtlicher war. Und Bücher dieser Art sind sicher auch sehr angreifbar, aber wäre diese autoritäre Geste nicht auch wertvoll? Damit begeben wir uns in die Arena und haben etwas, über das man diskutieren kann.
Das stimmt. Der Hinweis auf eigene Vorlieben bei der Lektüre ist auch etwas, was ich in meinen Texten immer wieder versucht habe. Das ist eine Form, die sehr wichtig sein könnte. Wie Sie schon sagen, waren Kaiser und Reich-Ranicki herausragende Figuren. Aber ich glaube nicht, dass es heute an solchen Figuren fehlt, auch in Deutschland nicht.
Ist es denn ein falscher Eindruck, dass weniger Bücher dieser Art erscheinen? Gerade im Studium können sie als Orientierung dienen, später kann man sie zum Teil auch kritisieren. Aber ein Orientierungsbedürfnis ist doch vorhanden, das von solchen Büchern bedient würde.
Maxim Biller könnte man so etwas vorschlagen, das wäre sicher interessant. Ich liebe ja Poetikvorlesungen besonders, weil darin die Lektüreerfahrung der Autoren zu finden ist. Wenn ich Autoren treffe, frage ich sie fast nur danach, was sie lesen, das hat mich immer total interessiert. Auch bei den Fragebögen, die wir früher bei VOLLTEXT gemacht haben, merkt man aber, wie gerade bei den Vorlieben herumgeeiert wird.
Man traut sich nicht, etwas Falsches zu sagen.
Ja, und sich lächerlich zu machen.
Wir haben den Eindruck, dass es im anglophonen Sprachraum weitaus mehr solcher Bücher gibt und es dort auch nicht als problematisch empfunden wird, seine eigenen Vorlieben bei der Lektüre klar zu benennen. Da ist auch mal ein Buch dabei, was möglicherweise belächelt oder als Unterhaltungsliteratur angesehen wird. Insgesamt scheint das doch ein anderer Zugang zu sein.
Das ist sicher ein Eindruck, den ich teilen würde. Und damit sind wir auch eigentlich wieder am Anfang: Das Hinweisen auf eigene Lektüren, die eigenen Vorlieben zu zeigen und klar herauszuarbeiten, gilt in vielen Kreisen als banal. Dabei ermöglicht genau das eine andere Reibungsfläche zur Literatur. Meine Sozialisierung lief so ab: „Lesen Sie das bis morgen, und dann reden wir darüber“. Das war bei Nizon in Paris so und auch hier in Wien bei Schmidt-Dengler. Es braucht eine gewisse Bereitschaft und jemanden, der mit dir darüber reden will und sich auch sehr offen zeigt. Wendelin Schmidt-Dengler hat mit einem sehr avancierten Besteck gearbeitet und sich vor allem nur mit der Gegenwartsliteratur beschäftigt. Er hat sich etwas gestellt, hat sich nicht zurückgezogen und war oft auch streitbar. Bernhard hat er nicht gemocht, Schrott hat er für einen Scharlatan gehalten. Das war eine Position. Auch wenn man Gegner von Reich-Ranicki ist, muss man sagen, dass er sich dem gestellt hat, was er nicht verstanden hat. Heute stellt man sich vielleicht zu wenig.
Wieso könnte das so sein?
Ich weiß nicht, ob es Gruppendruck ist, oder sozialer Druck, keine Ahnung. Im englischen Sprachraum ist vielleicht das Standing oder das Selbstvertrauen an sich größer.
Christoph Schröder sagt in seinem Kommentar zur Juryleistung des Bachmannpreises 2019 Folgendes über Sie: „Gmünder dürfte die kürzeste Redezeit aller Juroren gehabt haben, aber wenn er sprach, war er subtil und ironisch und sagte so schöne Sätze wie: ‚Es besteht die Gefahr, dass wir uns den Text hier zurechtreden‘“. Tut man Ihnen Unrecht, wenn man Ihr Temperament als Kritiker eher als zurückhaltendes und bescheidenes bezeichnet? Jemanden einen Scharlatan zu nennen, wäre nicht Ihre Sache, oder?
Vielleicht habe ich, wenn es um deutliche Ablehnung geht, zu viel Respekt vor dem, was die Autoren machen. Aber vielleicht geht es auch nicht um Respekt. Im Prinzip müsste man die völlige Distanz zu den Autoren haben, um eine Autorität zu sein.
Das stimmt schon, hat aber sicher viele Gründe und liegt nicht unbedingt am Temperament. Wenn ich etwas sage, rede ich lieber zur Sache. Außerdem weise ich lieber auf Elemente hin, die ich in einem Text für gelungen halte, als auf seinen Schwächen herumzureiten. Was nicht heißt, dass man Letztere verschweigt, man gewichtet sie aber anders.
Dabei ist die Zeitung so viel spannender, wenn auch ordentliche Verrisse darin stehen…
So etwas muss man den Kastbergers überlassen oder den Tinglers, die können das. Ich glaube, es braucht beides. Wenn ich etwas sage, dann sage ich es präzise; andere machen die Show. Im Zusammenspiel kann das etwas sehr, sehr Gutes haben.
Es braucht wohl wirklich beides. Trotzdem habe wir das Gefühl, es gibt zu wenige, die sich vortrauen. Wenn es einer tut – wie neulich Philipp Tingler – und dann behauptet, es gebe objektive Kriterien, um Literatur zu bewerten, ist das auch nicht hilfreich.
Wenn man rezensiert, kann man auch indirekt darauf hinweisen, dass es wirklich um etwas geht. Wenn ich Kritiken lese, habe ich aber oft das Gefühl, es gehe um nichts weiter als darum, einen nächsten Text fertigzustellen. Würde man den Diskurs weiter öffnen, kommt auch eine Replik und dann muss die Gegenstimme eben auch abgebildet werden. Vielleicht habe ich, wenn es um deutliche Ablehnung geht, zu viel Respekt vor dem, was die Autoren machen. Aber vielleicht geht es in der Kritik auch nicht um Respekt. Im Prinzip müsste man die völlige Distanz zu den Autoren haben, um eine Autorität zu sein. Wenn man Einleitungen schreibt oder Interviews macht, dann hat man diese Distanz nicht mehr. Das ist ein zweischneidiges Schwert.
Reich-Ranicki spricht von der Direktheit als Ausdruck der Höflichkeit der Kritik. Die andere Seite der Medaille sind seine zahlreichen Privatfehden und seine Klage darüber, wie einsam er Zeit seines Kritikerlebens gewesen sei. Darüber können Freundschaften zerbrechen.
Der Punkt mit der Deutlichkeit stimmt. Es passiert aber oft nichts weiter, außer, dass du zum Teil in den Postings als Idiot beschimpft wirst. Der Diskursrahmen ist schon auch enger geworden. Dabei ist es der Diskurs, der es ausmacht. Das Reden über Literatur. Fast alles, was ich über Literatur weiß, habe ich auf diese Weise gelernt. Darum sind die Autoren für mich eine so wichtige Quelle, mich hat immer interessiert, wie Literatur gemacht ist, wie sie formal funktioniert, wie man zum Beispiel nur mit Worten die Zeit in einzelnen Sätzen verlangsamt. So etwas hat mich immer mehr interessiert als die reine Kritik. Wenn Autoren darüber sprechen, geht es um eine Handwerklichkeit, von der du als Kritiker profitierst.
In Ihrem Buch Das wunde Leder. Wie Kommerz und Korruption den Fußball kaputt machen, das Sie gemeinsam mit Klaus Zeyringer geschrieben haben, findet sich ein schöner Satz: „Fußball kann man nicht erklären, man muss ihn spüren“. Hätten Sie auch Sportjournalist werden können und sich mit der gleichen Hingabe bemühen können, Fußball zu erklären, wie Sie es jetzt mit der Literatur machen?
Ich glaube schon. Als ich eine Zeit lang dabei war, hätte ich die Möglichkeit gehabt, in die Sportredaktion zu wechseln. Der Standard verfolgt eine relativ elaborierte, fast schon eine literarische Sportkritik, vor allem beim Fußball. Es war glaube ich einer meiner größeren Fehler, dass ich das nicht getan habe.
Eigentlich sehen Sie Literatur so wie Fußball – man kann sie nicht erklären, man muss sie spüren?
Ja, natürlich. Das gilt auch für die Liebe, das Leben, das Schicksal. Es gibt gewisse Dinge, die nicht erklärbar sind. Literatur kann Leben verändern und sie hat durchaus etwas Magisches. Das klingt jetzt sehr esoterisch.
Das ist die Gefahr, oder? In Winkels Rede kommen die Begriffe Religion und Magie auch vor. Man kann es nicht erklären, und trotzdem hat man den Drang, es zu explizieren und darüber ins Gespräch zu kommen. Mit diesem Widerspruch muss man in der Literaturkritik arbeiten. Natürlich gibt es Leute, die da die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, und wenn Maxim Biller sagt, deutsche Kritiker hätten Gulasch im Kopf, meint er genau das: diese aus der Romantik stammende, mehr dem Fühlen als dem Denken verbundene Tradition. Auch an dieser Position kann man berechtigte Kritik üben.
Darum ist es wichtig, genau zu wissen, was man als Kritiker tut, finde ich. Der eigene Zugang zum Text muss mitthematisiert werden. Ich halte Hubert Winkes Text Emphatiker und Gnostiker immer noch für den substanziellsten in diesem Zusammenhang geschriebenen Beitrag. Es geht darum, sich dieser Pole bewusst zu sein und mit ihnen umzugehen. Es ist relativ leicht zu sagen, was in einem Text formal misslungen ist – und sehr schwer herauszuarbeiten, warum ein Text total gelungen ist, sollte dies der Fall sein. Gerade beim wirklich Guten, das über seine Einzelteile und die Machart hinausgeht, ist es nicht leicht zu sagen, warum und wie das funktioniert. Die Kunstwerke, die sich über Jahrhunderte gehalten haben, verfügen über diesen Mehrwert und eine Gültigkeit, die über den Künstler und seine Zeit hinausgehen. Ich bin mir nicht sicher, ob man dem mit einem nur rationalen Besteck beikommt.
* * *
Zum Weiterlesen:
Philippe Djian: Betty Blue
Diogenes 1988
400 Seiten / 13 Euro
Kaufen im Shop der![]()
#supportyourlocalbookstore

Teofila Reich-Ranicki: Doktor Erich Kästners Lyrische Hausapotheke
DVA 2017
184 Seiten / 25 Euro
Kaufen im Shop der![]()
#supportyourlocalbookstore
Joachim Kaiser: Erlebte Literatur
Piper 2017
468 Seiten / 25 Euro

Hans Fallada: Lilly und ihr Sklave
Aufbau 2021
269 Seiten / 22 Euro
Kaufen im Shop der![]()
#supportyourlocalbookstore
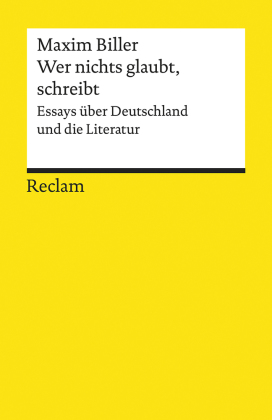
Maxim Biller: Wer nichts glaubt, schreibt
Reclam 2020
272 Seiten / 9,80 Euro
Kaufen im Shop der![]()
#supportyourlocalbookstore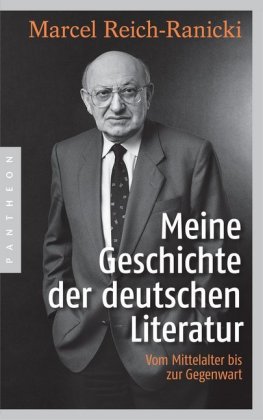
Marcel Reich-Ranicki: Meine Geschichte der deutschen Literatur
Diogenes 1988
576 Seiten / 16,99 Euro
Kaufen im Shop der![]()
#supportyourlocalbookstore
Stefan Gmünder / Klaus Zeyringer: Das wunde Leder
Suhrkamp 2018
128 Seiten / 12 Euro
Titelbild: geralt / pixabay.com

2 Kommentare zu „Autorität und Gespür – Interview mit Stefan Gmünder“