Von Matthias Fischli
Zweifel am Nutzen von Bildung hält sich hartnäckig (und wird auffallend häufig von männlichen Kritikern geäußert). Sie verderbe den Naturzustand des Menschen (Rousseau), führe zur „Spaltung der Gesellschaft“ (O-Ton eines anonymen rechtskonservativen Bürgers) oder zementiere in ihrer institutionalisierten Form soziale Ungleichheit (Aladin El-Mafaalani). Deniz Ohde widmet sich nun in ihrem Debütroman ‚Streulicht‘ dem Thema und lässt ihre Erzählerin um die Frage kreisen, warum sie so wurde, wie sie ist.
Streulicht entsteht, wenn elektromagnetische Strahlung sich an feinen Grenzflächen bricht. Es breitet sich aus als diffuses Schimmern, dass sich wie ein Mantel um die Lichtquelle legt. In Deniz Ohdes Roman ist diese Quelle ein namenloser deutscher Industriepark von der Größe einer Kleinstadt, in dessen Dunstkreis ihre genauso namenlose Erzählerin aufwächst. Der Ort ist ein typischer Nicht-Ort, keine Informationen dringen hinein, keine finden ihren Weg nach draußen. Nur dann und wann, wenn aus orangeweißem Nebel kristallisiertes Salz sich auf den Dächern und Straßen niederschlägt, „bekommen die Bewohner Gutscheine für die Autowäsche.“ Spärliche Kommunikation in einer toxischen Umwelt.
Die Luft hier ist „beinahe grün im Geruch“, eine „feine Säure“ liegt in ihr und sie ist dicker als anderswo, „als könnte man den Mund öffnen und sie kauen wie Watte.“ An diesen Ort kehrt die Erzählerin als junge Akademikerin zurück, weil Sophia und Pikka, mit denen sie als Kind eng befreundet war, heiraten wollen. Die beiden schweben als kleinbürgerliche Schatten aus der Vergangenheit durch die Erzählung: studiert, aber seltsam gesichtslos, sie sind für immer an den Ort gebunden. Das alte Zuhause konfrontiert die Erzählerin mit ihren Erinnerungen und löst bei ihr eine Suchbewegung aus. Warum gibt es bei ihr eine „Schneise im Lebenslauf“, und warum fragen die Leute immer, warum das so sei? Sie sucht nach Anfangsgründen für die Wendungen in ihrem Leben. Rückblenden bringen Licht ins Dunkle: Das passives Streu- weicht einem aktiven Streiflicht.
Der suchende Blick der Erzählerin beleuchtet ihre Kindheit, ihre Jugend und die Vergangenheit ihrer Eltern. Ihre Mutter stammte von der türkischen Schwarzmeerküste und flüchtete vor ihrer Mutter, die sie schlug. In Deutschland liierte sie sich mit einem Arbeiter aus dem Industriepark und hatte eine Tochter mit ihm. Der Vater der Erzählerin tunkte vierzig Jahre lang vierzig Stunden die Woche Aluminiumbleche in Lauge. Er trank, wurde Frau und Kind gegenüber gewalttätig und widmete sich dem obsessiven Sammeln von Schrott, mit dem er die Wohnung anfüllte. „Wenn ich auch nur einmal zu schnell über den Flur ging, zu Zeiten, in denen die Wohnzimmertür verschlossen blieb, trat er schon an mich heran, die flache Hand angespannt, nah vor meinem Gesicht. ‚Ich schlage dich nicht, ich bin nicht so jemand‘, sagte er.“
Mit Vermeidungsstrategien entging sie ihrem Vater, aber auch ihrem Lehrer, Herrn Kaiser. Sie legte sich eine unscheinbare Körperhaltung an, ein neutrales Lächeln, verlor ihre Sprache. Mit tiefgreifenden Folgen: „Es war keine Identität, die sich herausbildete, sondern eher wurde sie mir entzogen, verschwand im Keller der Schule, zwischen den bis in die Sechziger zurückreichenden Akten.“ Ohne die Hilfe ihrer bildungsfernen Eltern flog die Erzählerin von der Schule, verlor sich in Lethargie, fing sich mühsam wieder, besuchte die Abendschule und wurde dort zum ersten Mal von einer Lehrerin motiviert, holte das Abitur nach und ging in eine fremde Stadt, um zu studieren. Doch die kleinen und großen Benachteiligungen, die sie von Lehrpersonen und Mitschüler*innen erfuhr, von Fremden und Verwandten, konzentrierten sich in ihr wie giftige Industrieabfälle in einem stehenden Gewässer. „Die ständige Anspannung, unter der ich im Klassenraum saß, die Alarmbereitschaft vor der geschlossenen Wohnzimmertür, dieses ständige Abwehren von Gefahren nistete sich in meinem Körper ein.“
Vor wenigen Tagen besprachen wir hier den Debütroman Die Sommer. Ronya Othmanns Erstling verhandelt die drohende Auslöschung jesidischer Orte, Kultur und Erzählungen. Deniz Ohdes Erzählerin kämpft mit der drohenden Auslöschung ihrer deutschen Identität: „Ich hatte nur eine Muttersprache, ich hatte nur einen Geburtsort, ich hatte einen deutschen Nachnamen und zwei Vornamen, von denen der eine geheim war, ich rasierte mir die Monobraue, ich sagte: ‚Nicht ich bin Türkin, sondern meine Mutter.‘“
Debüts werden oftmals von einer Dringlichkeit in der Sprache getragen (so auch bei Othmann), entfacht von einem Zwang zum Schreiben. Auch Deniz Ohde schreibt sich frei: Die 1988 Geborene ist mit einer türkischstämmigen Mutter in Frankfurt am Main aufgewachsen und verließ ihre Familie, um in Leipzig Germanistik zu studieren. Über Autobiographisches zu spekulieren scheint hier müßig, wichtiger ist: Das Drängen wird bei Ohde so kanalisiert, dass eine schnörkellose, beinahe spröde Stimme resultiert. Für die Effekte intersektionaler Diskriminierung (die Erzählerin ist eine Frau, stammt von einer türkischstämmigen Mutter ab, die Arbeit des Vaters bestimmt ihre soziale Klasse) gab es in der deutschsprachigen Literatur bis jetzt keine adäquate Sprache. Deniz Ohde hat sie gefunden.
Sie funktioniert so: Die von einem feinsinnigen Sensorium registrierten Angriffe von außen schlagen sich in sehr genauen Beschreibungen nieder. Trockene Sätze machen die Bedrohung physisch: „Es war keine Langeweile, die mich nach draußen trieb, wie in den Filmen, sondern eine Schwere und eine beständige Übelkeit im Magen, die nur aufhörte, wenn mein Vater mich im Auto durch die Gegend fuhr. Ein Sprung in der Windschutzscheibe befand sich genau gegenüber dem Beifahrersitz, an dem ich mich mit beiden Händen festhielt, als handelte es sich um eine Achterbahnfahrt, und die Ampeln und Verkehrsschilder zerbrachen zu Fragmenten.“ In der Welt dringt ihre Beobachtungsgabe bis auf die Ebene von Atomen, in der Sprache bis auf die Ebene der Phoneme: Sophia sagt „türkich“ mit ch statt sch, „als mache sie sich sonst die Zunge daran schmutzig.“
Das Buch liest sich so, als ob durch das sprachliche Ansteuern von Anfangsgründen und die präzise Wiedergabe von Mustern der Ungleichheit die hermeneutische Ungerechtigkeit, an der die Erzählerin als stumme Jugendliche unwissentlich litt, aufgehoben würde. Damit ist dieses Debüt viel mehr als nur ein Bildungsroman.
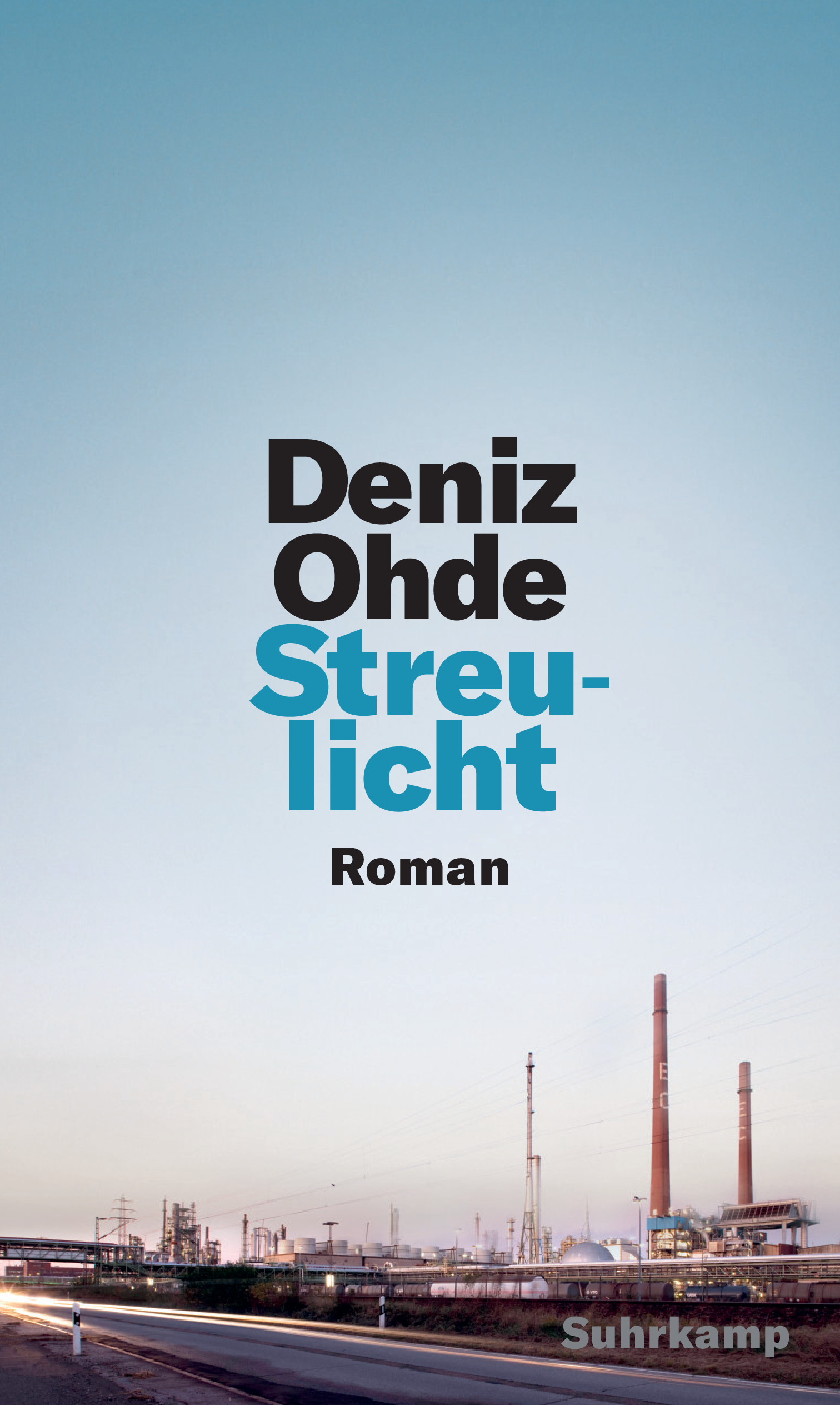
Deniz Ohde: Streulicht
Suhrkamp 2020
284 Seiten / 22 Euro
Foto: Foto-Rabe / pixabay.com

Ich lese den Roman auch gerade und bin begeistert von Deniz Ohdes nüchterner Erzählweise, die nichts beschönigt, nichts weglässt. Ein wichtiges Buch, das vorhandene Ungleichheiten und Rassismen in Deutschland klar zur Sprache bringt und offenlegt.
LikeGefällt 1 Person
Treffend zusammengefasst, lieber Florian – herzlichen Dank dir!
LikeLike